Ich weiß, dass viele meiner Blogbesucher längere Texte (zumindest online) nicht lesen. Dennoch will ich hier das einleitende Kapitel eines geplanten Buches vorstellen und fragen: Lädt das zum Weiterlesen ein? Will der Leser wissen, wie es weiter ging? Möchte die Leserin mehr erfahren? Ist das gut formuliert, ansprechend erzählt?
Ein kurzer Kommentar diesbezüglich, hier oder via Facebook oder Email, ist mir sehr willkommen. Auch Tipps und Hinweise werden nicht verschmäht.
So, genug der Vorrede, hier ist das Kapitel 1 eines bisher namenlosen und weitgehend ungeschriebenen Buches:
---
Ich hatte meine erste Krebserkrankung so gründlich vergessen, dass ich allen Ernstes und guten Gewissens verneinend antwortete, als die Ärztin bei der Aufnahme ins Krankenhaus nach vorangegangenen Tumoren fragte. Ich erwähnte im Anamnesegespräch zwar eine viel länger zurückliegende Bandscheibenoperation, aber was ich ziemlich genau zehn Jahre zuvor erlebt hatte, fiel mir nicht ein. Das mag weniger an Vergesslichkeit gelegen haben als an meinem miserablen Zustand bei der Notaufnahme, aber sicher spielte es auch eine Rolle, dass das Thema Krebs für mich ein endgültig abgeschlossenes und weitgehend vergessenes Kapitel meiner Vergangenheit war.
Harmlos war jenes Kapitel allerdings nicht gewesen. »Hodenkrebs ist eine bösartige Erkrankung, die in einem der beiden Hoden beginnt und im weiteren Verlauf auch Nebenhoden und Samenleiter erfassen kann. … Mit einem Anteil von etwa 1,6 Prozent aller Krebsneuerkrankungen ist Hodenkrebs eine eher seltene Tumorerkrankung.« fasst die Deutsche Krebsgesellschaft zusammen.[1] Dass etwas nicht in Ordnung war, wusste ich, sonst hätte ich an jenem Nachmittag des 5. März 2002 nicht einem Urologen gegenüber gesessen. Mit 46 Jahren dachte ich noch nicht darüber nach, ob regelmäßige Krebsvorsorgeuntersuchungen sinnvoll und notwendig sein mochten oder nicht. Dass ich zur Untersuchung gegangen war, hatte einen konkreten Grund: Der rechte Hoden, seit der Kindheit deutlich größer als der linke, war in den letzten Monaten deutlich gewachsen und verursachte inzwischen hin und wieder einen ziehenden Schmerz. Dass so etwas nicht normal und alltäglich war, darüber war ich mir im Klaren. Als ich jedoch die Diagnose aus dem Mund des Arztes hörte, traf es mich doch wie ein Schlag in die Magengrube: »Sie haben Krebs. Wir müssen so schnell wie möglich operieren.«
Krebs. Nicht eine Wucherung, oder eine seltene Struktur oder etwas anderes, das einen weniger furchteinflößenden Namen gehabt hätte. Sondern klar, unmissverständlich und ohne Umschweife: Krebs.
Anlässlich einer Vasektomie war ich rund ein Jahr zuvor erstmals im Leben beim Urologen gewesen. Er hatte den Eingriff durchgeführt und dabei nebenbei angemerkt, dass eine Untersuchung des rechten Hoden anzuraten sei, da dieser beim Tastbefund in Konsistenz und Größe auffällig war. Weil ich jedoch seit der Kindheit an unterschiedlich große Hoden gewohnt war und mir in den Jahrzehnten zuvor keine Veränderung aufgefallen war, hielt ich die Angelegenheit nicht für dringend. Monat für Monat verschob ich die Untersuchung. Es gab immer so viel anderes zu tun und Wichtigeres zu bedenken – im Grunde genommen war allerdings meine (wohl typisch männliche) Scheu, die Geschlechtsorgane untersuchen zu lassen, ausschlaggebend. Das »starke Geschlecht« hat ja so manche schwachen Punkte; einer davon ist die verbreitete Abneigung gegen Termine beim Urologen. Bei mir kam Unkenntnis hinzu: Ich wusste nicht, dass eine regelmäßige gründliche Selbstuntersuchung und erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich auch kleiner Veränderungen der Hoden schon ab dem Jugendalter lebensrettend sein können. Das hatte mir nie jemand gesagt, das hatte ich nirgends gelesen.
 Nun, an diesem Dienstag im März 2002, musste ich der Tatsache ins Auge sehen. »Sie haben Krebs.« Daran war nichts unklar oder zweideutig und das konnte ich nicht auf die leichte Schulter nehmen oder gar ignorieren. Ich ließ mich aufklären: Hodenkrebs ist immer bösartig. Wenn er früh entdeckt und behandelt wird, bestehen jedoch gute Heilungschancen – so gesehen ist es noch die am wenigsten gefährliche Krebserkrankung. Wenn der Tumor früh entdeckt wird. Bleibt er dagegen unbehandelt, breitet er sich meist zügig aus und befällt lebenswichtige Organe. So wird das zunächst lokal begrenzte und behandelbare Karzinom innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit zur Todesursache. Mit 46 Jahren sei ich an und für sich »zu alt, um noch an Hodenkrebs zu erkranken«, erklärte mein Urologe, der sich Vorwürfe machte, dass er nach der Vasektomie nicht energisch genug nachgehakt hatte. Nun bestand kein Zweifel an der Diagnose – es gibt eben immer Ausnahmen von der medizinischen Regel.
Nun, an diesem Dienstag im März 2002, musste ich der Tatsache ins Auge sehen. »Sie haben Krebs.« Daran war nichts unklar oder zweideutig und das konnte ich nicht auf die leichte Schulter nehmen oder gar ignorieren. Ich ließ mich aufklären: Hodenkrebs ist immer bösartig. Wenn er früh entdeckt und behandelt wird, bestehen jedoch gute Heilungschancen – so gesehen ist es noch die am wenigsten gefährliche Krebserkrankung. Wenn der Tumor früh entdeckt wird. Bleibt er dagegen unbehandelt, breitet er sich meist zügig aus und befällt lebenswichtige Organe. So wird das zunächst lokal begrenzte und behandelbare Karzinom innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit zur Todesursache. Mit 46 Jahren sei ich an und für sich »zu alt, um noch an Hodenkrebs zu erkranken«, erklärte mein Urologe, der sich Vorwürfe machte, dass er nach der Vasektomie nicht energisch genug nachgehakt hatte. Nun bestand kein Zweifel an der Diagnose – es gibt eben immer Ausnahmen von der medizinischen Regel.
Meine Frau Eva war es, die mich in jenen Tagen im März 2002 getragen hat, mit ihren Gebeten, ihrem Zuspruch, ihrer Hoffnung, ihrer Liebe. Es ist wohl etwas Wahres daran, dass sich vor allem in ernsthaften Krisen zeigt, was man an seinem Ehepartner wirklich hat. Ich selbst war nach dem Gespräch mit dem Urologen wie gelähmt und voller Angst. Ich wollte fliehen – aber wohin? Vor einem Tumor, der im eigenen Körper wächst, kann man nicht davonlaufen. Ich sah eigentlich nur noch schwarz. Eva stand natürlich ihrerseits Ängste und Sorgen durch, aber es gelang ihr trotzdem, mich immer wieder zu ermutigen und zu stützen. Was sie in dieser Zeit für mich getan hat, kann ich (so sehr ich auch damals, vor nunmehr vierzehn Jahren, und auch jetzt wieder nach Worten dafür gesucht habe) nicht ausdrücken.
Der Glaube an und für sich, sagt der Volksmund, versetzt Berge. » Fürchte dich nicht, glaube nur!« fordert dem Evangelium nach Markus zufolge Jesus einen verzweifelten Vater, dessen Tochter im Sterben liegt, auf.[2] So etwas liest sich leicht und man kann auch mit dem Kopf nicken, wenn es einem gut geht. Mein Glaube an einen barmherzigen Gott, der es gut mit mir meint und mich vor Unheil bewahrt, war durch die Krebsdiagnose allerdings so erschüttert, dass ich selbst nicht in der Lage oder willens war, zu beten. Am Donnerstag, dem 7. März, kamen mein Pastor und der Gemeindevorstand, um mich dem biblischen Exempel gemäß mit Öl zu salben und für meine Heilung zu beten. Während dieses Besuchs empfand ich zwar, dass zum ersten Mal seit der Diagnose ein wenig innere Ruhe einkehrte, ich wusste allerdings nach wie vor nicht, wie es mit meiner Krankheit weitergehen würde. Ich war keineswegs plötzlich in der Lage, Glauben für meine Heilung aufzubringen oder auch nur selbst ein Gebet zu formulieren. Eva, der Pastor und seine Begleiter beteten für mich, und das half meinem seelischen Gleichgewicht immerhin ein wenig aus der Schieflage. Doch der Hoffnungsschimmer während dieses Besuches erwies sich als fragil. In den nächsten Tagen und Nächten blieb es dabei, dass ich meist nur Angst empfand, denn es gab ja nichts an den Tatsachen zu rütteln. Ich wusste, dass ich eine tödliche Krankheit verschleppt hatte (ohne mir dessen bewusst zu sein, aber das änderte nichts an den Fakten) und dass nach menschlichem Ermessen und allen medizinischen Erfahrungen der Krebs inzwischen Lymphdrüsen, Lunge und weitere Organe befallen haben konnte. Mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Am Mittwoch, dem 13. März 2002, acht Tage nach der Diagnose, wurde ich dann endlich ins Krankenhaus aufgenommen. Die Operation sollte am nächsten Vormittag stattfinden. Man gab mir für die Nacht ein Beruhigungsmittel, aber so richtig tief schlafen konnte ich nicht. Die Gedanken kreisten um meine Familie und ich wachte häufig auf. Dabei bemerkte ich etwas irritiert: Je näher die Operation rückte, desto ruhiger und friedlicher wurde ich innerlich. Es gab keinen äußeren Anlass dafür, nichts hatte sich verändert. Aber die Nervosität und Furcht nahmen nicht zu, sondern ab – am viele Stunden zuvor verabreichten Beruhigungsmittel konnte es kaum liegen, denn die Wirkung musste ja mittlerweile eher schwinden als zunehmen.
Als ich am Nachmittag des 14. März 2002 aus der Narkose aufwachte, erfuhr ich, dass die Ärzte während der Operation einen Leistenbruch festgestellt und diesen gleich mit operiert hatten. Ich würde mich auf einen längeren Krankenhausaufenthalt einrichten müssen, bis die Wunde verheilt und meine Kräfte wiederhergestellt sein würden, sagte man mir. Erfahrungsgemäß etwa zehn Tage, wenn alles gut ging.
Das Krankenzimmer war ausgesprochen hässlich, meine beiden Bettnachbarn keine sonderlich angenehme Gesellschaft und meine Klagen über die Missstände in der Betreuung der Patienten im Frühjahr 2002 (ganz anders als zehn Jahre später) könnten ein eigenes Buch füllen. Doch will ich nicht klagen, deshalb bleibt dieses Buch ungeschrieben. Ärzte und Pflegepersonal waren einfach überarbeitet, schlecht bezahlt und die Zukunft ihrer Arbeitsplätze stand in jenen Tagen im Universitätsklinikum Steglitz auf der Kippe. Das machte sich deutlich bemerkbar.
Kurzum – ich fühlte mich im Krankenhaus sehr unwohl und wollte nach Hause. Als mich am Abend nach der Operation, also am Donnerstag, unser Pastor besuchte, sagte ich halb im Scherz, halb ernst gemeint: »Vielleicht sehen wir uns Sonntag im Gottesdienst...«
Am Freitag ging es mir erbärmlich – Schmerzen, Übelkeit, Schwindelanfälle dominierten – am Abend bekam ich noch dazu leichtes Fieber. Morgen kannst du nach Hause gehen. Dieser Gedanke war irgendwie nicht loszuwerden. Ich schob das Wunschdenken, womöglich durch Fieber oder Medikamente beflügelt, beiseite und dachte: Schön wär’s, aber bleib mal lieber realistisch.
Als ich am Samstag früh aufwachte, wunderte ich mich über mein Wohlbefinden. Ich hatte keine Schmerzen, keine Spur von erhöhter Temperatur und als ich aufstand, um ein paar Runden über den Krankenhausflur zu laufen, war ich zwar noch etwas geschwächt, aber mir wurde nicht schwindelig. Ich konnte fast nicht glauben, wie gesund ich mich fühlte. Ich hatte – dies am Rande – einen Bärenhunger, keine Spur von Übelkeit war noch zu spüren.
Als der Arzt mit seinem Tross von Schwestern und Assistenten zur Visite kam, fragte ich ihn, wann ich denn mit meiner Entlassung rechnen könnte.
»Sobald die Wunde verheilt ist, falls sich keine Entzündungen bilden.«
»Dann kann ich also jetzt nach Hause?« fragte ich.
Er schien etwas aus dem Konzept gebracht und blätterte in seinen Unterlagen. »Wann wurden Sie operiert?«
»Vorgestern. Vor etwa 48 Stunden.«
»Na, sehen Sie, dann können wir Sie frühestens zum nächsten Wochenende entlassen, durch die erweiterte Operation wegen des Leistenbruchs ist der Schnitt verhältnismäßig lang und tief. Das braucht seine Zeit.«
Ich bat ihn, doch den Verband zu entfernen und sich die Wunde anzusehen. Er war begreiflicher Weise unwillig, tat mir dann aber den Gefallen. Vermutlich um mich zu überzeugen, dass ich Geduld aufbringen musste. Ich habe den ungläubigen Ausdruck auf seinem Gesicht nicht vergessen. Die Wunde war in ihrer ganzen Länge von 18 Zentimetern geschlossen, trocken und nur noch leicht gerötet.
Der Doktor schüttelte den Kopf und verschwabd samt seiner vielköpfigen Visitenbegleitung. Als er etwa eine Stunde darauf zurückkam, überprüfte er erst noch einmal, ob er den richtigen Patienten vor sich hatte und meinte dann: »Ich bin schon eine Weile Arzt, aber so etwas habe ich noch nie gesehen.«
»Dann darf ich also jetzt nach Hause?«
»Nein, das geht nicht.«
»Warum?«
»Weil es das noch nie gab, dass jemand 48 Stunden nach einer solchen Operation entlassen wurde.«
»Was würden Sie denn mit mir tun, wenn ich hier bliebe?«
Er überlegte. »Beobachten, Verband wechseln...«
»Und wenn ich Ihnen verspreche, am Montag zur Kontrolle zu kommen? Beobachten kann ich mich selbst. Den Verband wechseln auch. Wenn es mir schlechter geht, bin ich sofort hier.«
Wir argumentierten noch eine Weile hin und her, aber der Arzt musste eingestehen, dass es keinen triftigen Grund gab, mich im Krankenhaus zu behalten außer dem, dass es eine so schnelle Genesung noch nie gegeben hatte. Schließlich wurde ich um kurz nach zehn Uhr entlassen, mit ärztlicher Zustimmung.
Stichhaltig erklären kann ich das Geschehen nicht, aber für mich war und ist dieses schier unfassbare Erlebnis auf das Wirken göttlicher Heilungskraft zurückzuführen. Es gab Freunde, die von »außergewöhnlichen Selbstheilungskräften« sprachen – es sei dahingestellt, da ich eine Erklärung sowieso nicht anzubieten in der Lage bin. Ich war sehr sehr froh und dankbar, aus dem unwirtlichen Krankenzimmer nach Hause zu kommen. Und am Sonntag besuchte ich tatsächlich, noch recht schwach auf den Beinen, aber immerhin, den Gottesdienst.
In der darauffolgenden Woche wurde mein Fall von der Tumorkonferenz besprochen. Die Tumorkonferenz ist ein regelmäßiges Treffen von Onkologen und anderen Fachärzten im Universitätsklinikum, bei dem die aktuellen Krebsfälle besprochen und Empfehlungen für die Weiterbehandlung der Patienten beschlossen werden.
In meinem Fall lautete der Rat der Konferenz: Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen in den nächsten Jahren. Eine Chemotherapie oder Bestrahlungen wurden nicht empfohlen, da der Tumor im Stadium 2 wider Erwarten lokal begrenzt gewesen war und restlos entfernt werden konnte. Befallene Lymphgefäße wurden nicht festgestellt und es gab weder im Blutbild noch anhand der Auswertung des MRT Anzeichen von weiteren Tumoren.
Im Sommer 2007 stand für mich fest, dass ich endgültig geheilt war. Inzwischen lagen fünf Jahre mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen hinter mir. Es gab keinerlei Hinweise auf Krebszellen in meinem Körper, die Ergebnisse ließen ausnahmslos auf eine vollständige Heilung schließen. Ich war natürlich froh und dankbar, fragte mich aber damals auch immer wieder: Warum ich?
Ich kannte Menschen, die trotz Gebet nicht gesund geworden waren. Ich kannte andere, deren Gebete um Heilung (auch von schweren Leiden) erhört wurden. Die Antwort auf das Warum werde ich wohl in diesem Leben nicht finden. Das macht aber nichts. Als Jesus den biblischen Texten zufolge gefragt wurde, ob Sünde der Vorfahren oder eigene Schuld der Grund für die Blindheit eines Menschen waren, antwortete er: »Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden.« Es gelingt mir bis heute nicht, dieser Äußerung sonderlich viel Verständnis oder gar Sympathie entgegen zu bringen. Das ist aber auch gar nicht notwendig – denn wer wäre ich als Mensch, dass ich die Logik oder den Sinn göttlichen Handelns oder Nichthandelns beurteilen könnte? Johnny Cash hat es einmal so ausgedrückt: »My arm is just a little too short to wrestle with God.«
Ich kann mich gut erinnern, dass ich 2007, nach Ablauf der kritischen fünf Jahre, dankbar war. Ich wusste, dass ich mir meine Gesundheit in keiner Weise verdient oder erarbeitet hatte. Noch nicht einmal durch einen sogenannten festen Glauben oder unerschütterliches Vertrauen. Glauben für meine Heilung hatte ich, als der Krebs in einem so späten Stadium diagnostiziert worden war, nicht aufgebracht, Hoffnung konnte ich nicht schöpfen. Alles was ich hatte aufbringen können, war der Wunsch, mein Leben in der Hand Gottes zu wissen, jegliche Gewissheit darüber war mir damals abhanden gekommen. Soweit, wie ich auch heute noch annehme, bei meiner wunderbar schnellen und dauerhaften Genesung göttliche Kraft wirksam war, handelte es sich um ein unerklärliches, unverdientes aber gleichwohl natürlich sehr willkommenes Geschenk.
Wenn fünf Jahre nach einer Krebsbehandlung der Patient immer noch frei von Tumoren ist, gilt er medizinisch als geheilt. Das heißt nicht, dass er nicht erneut an Krebs erkranken kann, aber die statistische Wahrscheinlichkeit entspricht nach Ablauf dieser Frist wieder der des Bevölkerungsdurchschnitts.
Ich war im Sommer 2007 überzeugt, das Kapitel Krebs in meinem Leben abgeschlossen und hinter mich gebracht zu haben. Nach und nach schwand trotz aller Dankbarkeit und Freude dann die lebhafte Erinnerung an all die Empfindungen und Erlebnisse, da der Alltag und das Gesundsein wieder zur Normalität wurden. So normal, dass mir am 14. März 2012 bei der Anamnese in der Notaufnahme des gleichen Klinikums nicht einfiel, dass ich zehn Jahre zuvor Hodenkrebs gehabt hatte.
[1] Quelle: https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/andere-krebsarten/hodenkrebs.html
[2] Markus 5, 36
P.S.: Bild eines Seminoms von Wikipedia

 Gründen trug, stand Real women love Jesus. Die Dame sang und rief abwechselnd mit lauter Stimme allerlei Parolen, den Passanten schien das weitgehend gleichgültig zu sein, jedenfalls blieb niemand stehen, um zuzuhören. Außer einem Herrn, den ich zuerst nur von hinten sah, aber dennoch ziemlich schnell erkannte. Es war Herr K.
Gründen trug, stand Real women love Jesus. Die Dame sang und rief abwechselnd mit lauter Stimme allerlei Parolen, den Passanten schien das weitgehend gleichgültig zu sein, jedenfalls blieb niemand stehen, um zuzuhören. Außer einem Herrn, den ich zuerst nur von hinten sah, aber dennoch ziemlich schnell erkannte. Es war Herr K. Vom Nebentisch drang würzig-süßer Rauch zu uns herüber, ein Joint machte dort die Runde. Ich erinnerte mich zurück an meine Hippiezeit und an manches Erbrechen nach dem Genuss gewisser Substanzen … aber darauf wollte Herr K. ja wohl eher nicht hinaus. Ich antwortete: »Ja, aber das würde ich nicht als notwendigen oder entscheidenden Punkt bezeichnen, was meinen Entschluss betrifft, an Gott und Christus zu glauben. Geschadet hat das Übergabegebet damals zwar auch nichts, aber der Abend, an dem das Übergabegebet stattfand, war kein dauerhafter Wendepunkt in meinem Leben.«
Vom Nebentisch drang würzig-süßer Rauch zu uns herüber, ein Joint machte dort die Runde. Ich erinnerte mich zurück an meine Hippiezeit und an manches Erbrechen nach dem Genuss gewisser Substanzen … aber darauf wollte Herr K. ja wohl eher nicht hinaus. Ich antwortete: »Ja, aber das würde ich nicht als notwendigen oder entscheidenden Punkt bezeichnen, was meinen Entschluss betrifft, an Gott und Christus zu glauben. Geschadet hat das Übergabegebet damals zwar auch nichts, aber der Abend, an dem das Übergabegebet stattfand, war kein dauerhafter Wendepunkt in meinem Leben.« Nun geht es weiter mit den Geschichten, die ein gewisser Lukas so oder so ähnlich aufgeschrieben hat.
Nun geht es weiter mit den Geschichten, die ein gewisser Lukas so oder so ähnlich aufgeschrieben hat. 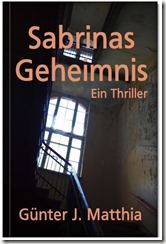



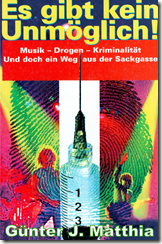
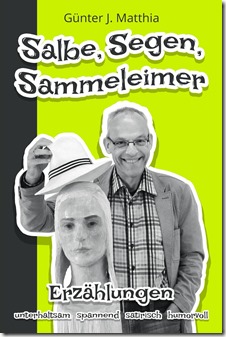
 Demnächst (1) erscheint ein neues Buch aus meiner Feder: Satirisches, Unterhaltsames, Spannendes und Ernsthaftes vom Heimatkrimi bis zur Begegnung mit biblischen Personen aus ganz und gar ungewohnter Perspektive.
Demnächst (1) erscheint ein neues Buch aus meiner Feder: Satirisches, Unterhaltsames, Spannendes und Ernsthaftes vom Heimatkrimi bis zur Begegnung mit biblischen Personen aus ganz und gar ungewohnter Perspektive. 
![Neuland von [Matthia, Günter J.]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51N6N4anjvL.jpg) Ab heute (Montag, 24. Juli 2017) bis zum Freitag gibt es mein Buch Neuland als Kindle-Version kostenlos. Noch preiswerter geht nun wirklich nicht.
Ab heute (Montag, 24. Juli 2017) bis zum Freitag gibt es mein Buch Neuland als Kindle-Version kostenlos. Noch preiswerter geht nun wirklich nicht. Wir tranken. Ich hatte keine Angst vor der Anakonda. Der Brujo fragte, was ich mir wünschte. Als ich es ihm ins Ohr flüsterte, schüttelte er den Kopf und meinte, er sei leider kein A-Kon.
Wir tranken. Ich hatte keine Angst vor der Anakonda. Der Brujo fragte, was ich mir wünschte. Als ich es ihm ins Ohr flüsterte, schüttelte er den Kopf und meinte, er sei leider kein A-Kon.  stande kamen, die zu bis heute andauernder Freundschaft führten.
stande kamen, die zu bis heute andauernder Freundschaft führten.  Zum Beispiel der Gebrauch des Verbs »realisieren«. Jedem Menschen mit Internetzugang steht seit Jahren kostenlos der Zugang zum Duden zur Verfügung. Zu Bedutungswörterbüchern und Überstzungshilfen gleichermaßen. Wenn jemand soziale Netzwerke nutzt, ist es also weder technisch ein Problem, sich über die Bedeutung und den Gebrauch von Worten zu informieren, noch kostet es zusätzliches Geld. Und dennoch wurde und wird »realisieren« immer häufiger falsch verwendet. Der Ursprung dürfte in mangelnder Sprachkenntnis des Englischen gelegen haben. Da las jemand »he realized …« und tippte »er realisierte«. Das ist reine Dummheit im Sinne der Definition am Beginn dieses Beitrages. Aber es hat sich fortgesetzt und lawinenartig verbreitet.
Zum Beispiel der Gebrauch des Verbs »realisieren«. Jedem Menschen mit Internetzugang steht seit Jahren kostenlos der Zugang zum Duden zur Verfügung. Zu Bedutungswörterbüchern und Überstzungshilfen gleichermaßen. Wenn jemand soziale Netzwerke nutzt, ist es also weder technisch ein Problem, sich über die Bedeutung und den Gebrauch von Worten zu informieren, noch kostet es zusätzliches Geld. Und dennoch wurde und wird »realisieren« immer häufiger falsch verwendet. Der Ursprung dürfte in mangelnder Sprachkenntnis des Englischen gelegen haben. Da las jemand »he realized …« und tippte »er realisierte«. Das ist reine Dummheit im Sinne der Definition am Beginn dieses Beitrages. Aber es hat sich fortgesetzt und lawinenartig verbreitet.  Es ist jedoch nicht nur der falsche Gebrauch von Begriffen und Redewendungen zu beklagen, sondern auch die Dummheit, die sich daran zeigt, dass manche Worte vielen Zeitgenossen gar nicht mehr bekannt sind. Zum Beispiel der Begriff »Abstimmung«. Da wird beispielsweise von der Redaktion einer seriösen Sendeanstalt zum »Voting« eingeladen. Hinz und Kunz tippen unbekümmert (meist mit Großbuchstaben am Anfang) »Voten«, wenn »abstimmen« gemeint ist. »Vot
Es ist jedoch nicht nur der falsche Gebrauch von Begriffen und Redewendungen zu beklagen, sondern auch die Dummheit, die sich daran zeigt, dass manche Worte vielen Zeitgenossen gar nicht mehr bekannt sind. Zum Beispiel der Begriff »Abstimmung«. Da wird beispielsweise von der Redaktion einer seriösen Sendeanstalt zum »Voting« eingeladen. Hinz und Kunz tippen unbekümmert (meist mit Großbuchstaben am Anfang) »Voten«, wenn »abstimmen« gemeint ist. »Vot en und gewinnen!«, liest man, und »Leute, Votet jetzt!«. Es ist ein Graus.
en und gewinnen!«, liest man, und »Leute, Votet jetzt!«. Es ist ein Graus.  Statt dessen schreiben sie »Ein Hammer Film«, »das war echt der Hammer« oder »boah ey! Hammer!«. Gibt es außer der Werkzeugkiste denn keine anderen Analogien mehr? Als Steigerung fällt ihnen dann nur noch »geil« ein. Ursprünglich bezeichnete das Wort umgangssprachlich sexuelle Erregung oder deren auslösendes Moment, inzwischen ist es zum Ersatzwort für »gut« geworden.
Statt dessen schreiben sie »Ein Hammer Film«, »das war echt der Hammer« oder »boah ey! Hammer!«. Gibt es außer der Werkzeugkiste denn keine anderen Analogien mehr? Als Steigerung fällt ihnen dann nur noch »geil« ein. Ursprünglich bezeichnete das Wort umgangssprachlich sexuelle Erregung oder deren auslösendes Moment, inzwischen ist es zum Ersatzwort für »gut« geworden.  Nun, an diesem Dienstag im März 2002, musste ich der Tatsache ins Auge sehen. »Sie haben Krebs.« Daran war nichts unklar oder zweideutig und das konnte ich nicht auf die leichte Schulter nehmen oder gar ignorieren. Ich ließ mich aufklären: Hodenkrebs ist immer bösartig. Wenn er früh entdeckt und behandelt wird, bestehen jedoch gute Heilungschancen – so gesehen ist es noch die am wenigsten gefährliche Krebserkrankung. Wenn der Tumor früh entdeckt wird. Bleibt er dagegen unbehandelt, breitet er sich meist zügig aus und befällt lebenswichtige Organe. So wird das zunächst lokal begrenzte und behandelbare Karzinom innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit zur Todesursache. Mit 46 Jahren sei ich an und für sich »zu alt, um noch an Hodenkrebs zu erkranken«, erklärte mein Urologe, der sich Vorwürfe machte, dass er nach der Vasektomie nicht energisch genug nachgehakt hatte. Nun bestand kein Zweifel an der Diagnose – es gibt eben immer Ausnahmen von der medizinischen Regel.
Nun, an diesem Dienstag im März 2002, musste ich der Tatsache ins Auge sehen. »Sie haben Krebs.« Daran war nichts unklar oder zweideutig und das konnte ich nicht auf die leichte Schulter nehmen oder gar ignorieren. Ich ließ mich aufklären: Hodenkrebs ist immer bösartig. Wenn er früh entdeckt und behandelt wird, bestehen jedoch gute Heilungschancen – so gesehen ist es noch die am wenigsten gefährliche Krebserkrankung. Wenn der Tumor früh entdeckt wird. Bleibt er dagegen unbehandelt, breitet er sich meist zügig aus und befällt lebenswichtige Organe. So wird das zunächst lokal begrenzte und behandelbare Karzinom innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit zur Todesursache. Mit 46 Jahren sei ich an und für sich »zu alt, um noch an Hodenkrebs zu erkranken«, erklärte mein Urologe, der sich Vorwürfe machte, dass er nach der Vasektomie nicht energisch genug nachgehakt hatte. Nun bestand kein Zweifel an der Diagnose – es gibt eben immer Ausnahmen von der medizinischen Regel.